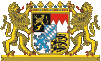Initiative Zukunftswald im Amtsgebiet
Der Lindenmischwald Haag – ein seltenes Kleinod
Die Linde - ein Baum der verbindet
Podcast: Die Linde - ein Baum der verbindet

Lindenblatt
Ein Podcast von H.- C. Münnich
Entstehungsgeschichte
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Winterlinde in der Blüte (Foto: H.-C. Münnich)
Ein denkbares Szenario für die Entstehung ist, dass sich die Linden in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bereits unter einem lichten Altholzschirm ansamten und in der Jugend schattentolerant gut heranwuchsen, während sich die lichtbedürftigeren Birken, Eichen und Kirschen auf den lichteren Stellen im Wald behaupteten bzw. nach einer schnellen Nutzung des Vorbestandes zusammen mit der Kiefer, die möglicherweise gepflanzt wurde, einstellten.
Die einzeln eingemischten Laubhölzer entstammen sehr wahrscheinlich der natürlichen Verjüngung. Die Samen von Linde, Spitzahorn, Birke und Hainbuche werden dabei durch den Wind vertragen, die Verbreitung der schwerfrüchtigeren Eiche, Buche und Kirsche hingegen wird durch Tiere wie Eichelhäher oder Eichhörnchen unterstützt. Ein eindrückliches Beispiel für die Regenerationskraft des Waldes! Da früher Schutzvorrichtungen im bäuerlichen Wald nicht üblich waren, haben vermutlich zeitweise niedrige Rehwildbestände das Aufkommen der Mischbaumarten ermöglicht. In den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren wurde intensiv gejagt, was zur Reduktion der Wildbestände und damit des Verbisses führte und den Aufwuchs vieler, auch seltenerer Mischbaumarten ermöglichte.
Heute käme die beschriebene Verjüngung des Bestandes ohne Zaunschutz nicht zustande. Starker Wildverbiss verhindert den Aufwuchs der Sämlinge, dornenbewehrte oder vom Wild verschmähte Straucharten wie Schlehen und Rote Heckenkirschen setzen sich dort durch, wo bereits mehr Licht auf den Boden fällt. Es besteht die Gefahr, dass der Bestand zunehmend verwildert. Viele ausgesprochen gute, astfreie Stämme der Linden und deren mittlere Höhe von rund 25 m, legen die Vermutung nahe, dass sie in ihrer Jugend durch den Seitendruck anderer gleichaltriger Bäume so ausgeformt wurden. Unabdingbare Voraussetzung hierfür war aber eine gute genetische Veranlagung. Die guten Erbanlagen machen heute den Wert und die Einzigartigkeit des Lindenbestandes aus. Er wurde 2016 auf Initiative unseres Beratungsförsters und mit Zustimmung des Waldbesitzers als Saatgutbestand nach dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) anerkannt. Die Winterlinden dürfen seitdem zur gewerblichen Gewinnung wertvollen Lindensaatguts, das der Anzucht von Forstpflanzen dient, beerntet werden.
Eine Besonderheit des Bestands sind die zahlreichen Höhlenbäume heimischer Spechtarten, die auch einer Vielzahl anderer Tierarten als Behausung dienen.
Ausblick
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Eingeengte Lindenkronen
(Foto: H.-C. Münnich)
Sobald auf dem Holzmarkt wieder auskömmliche Preise erzielbar sind, wird mit dem ersten Eingriff eine Feinerschließung mit Rückegassen im Abstand von 30 m eingelegt. Im selben Zug werden auf der so eingeteilten Fläche die bestgeformten Linden markiert und von den 2 - 3 stärksten Bedrängern in der Krone und auch peitschenden Kiefern freigestellt. Nah aufeinander stehende Linden können dabei auch gemeinsam gefördert werden. Erstes Ziel ist der Kronenausbau und die Dimensionierung aller beerntungswürdigen Linden (Kronenpflege der Samenbäume zum Erhalt der Erntezulassung).
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Freigestellter Saatguterntebaum (Foto: Franz Laumer)
Der nächste Eingriff im Abstand von 5 - 8 Jahren sollte dann zur vollständigen Umlichtung der Samenbäume führen und eine vorsichtige Kronenpflege vitalerer Kiefern, die im Abstand von 8 -10 m zueinander oder zu Linden ausgewählt werden, beinhalten. Auf diese Weise kann der Bestand stabilisiert in seiner wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Wertigkeit gestärkt und auf eine längere Verjüngungsphase in 20 - 30 Jahren vorbereitet werden.

„Mein Wald – die Mischung macht´s“
In Zeiten des Klimawandels in denen ganze Fichten- und Kiefernwälder Hitze, Stürmen und Borkenkäfern zum Opfer fallen, liegen die Vorteile von Mischwäldern klar auf der Hand. Die in diesem Wald vorkommenden Baumarten wie Linden, Eichen, Kirschen, Spitzahorne und Birken kommen mit den steigenden Temperaturen und den geringeren Niederschlägen deutlich besser als Fichten und Kiefern zurecht. Reich strukturierte Mischwälder sind außerdem deutlich stabiler bei Schadereignissen wie Sturm, Insektenfrass oder Pilzbefall als einschichtige, dicht gedrängte Nadelholz-Monokulturen. Sollte dennoch wider Erwarten eine der Baumarten ausfallen, kann die entstandene Lücke jederzeit von einer anderen vorhandenen Baumart geschlossen werden. Damit fallen vielleicht einzelne Bäume den Folgen des Klimawandels zum Opfer, aber niemals der ganze Wald! Mischwald wirkt ferner einer Versauerung unserer wertvollen Waldböden entgegen und beherbergt eine Vielzahl unterschiedlichster Pflanzen- und Tierarten, die teilweise nur an einer bestimmten Baumart vorkommen. Mischwald ist aber auch aus wirtschaftlichen Gründen absolut sinnvoll: Ein Mischwald verfügt mit den verschiedensten Holzarten und Dimensionen über ein breites Holzangebot - nicht mehr Stürme und Käfer bestimmen die Holznutzung, sondern der Waldbesitzer kann gezielt diejenigen Sortimente einschlagen, die auf dem stets wechselnden Holzmarkt gerade gefragt sind.
Ein farbenprächtiger herbstlicher Bergmischwald mit Buche, Fichte und Tanne (Foto: Boris Mittermeier)